- Politik & Verwaltung
- Leben & Wohnen
- Erleben & Entdecken
- Onlineservices & Formulare
Kriegerdenkmal Somborn
S. Buchhaupt
Auf diesem Platz befinden sich drei Denkmale für vier Kriege im Zeitraum zwischen 1866 und 1945. Die ersten beiden Denkmale wurden auf Initiative des Kriegervereins Somborn errichtet, das dritte Denkmal – ein Mahnmal – durch die Gemeinde Somborn nach dem zweiten Weltkrieg. Für die Geschichtswissenschaft sind Denkmale Sachquellen. Gemäß dem Motto, dass Geschichte nicht nur in Büchern stattfindet, begannen einige Lehrer und
Schüler der Kopernikusschule, sich mit den Denkmalen zu beschäftigen. Diese
Informationstafel soll beim Verständnis der Aussagen der Denkmale helfen,
insbesondere aber die historischen Umstände ihrer Errichtung beleuchten. Nur eine
kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit kann zu dem oft geforderten
„Lernen aus der Geschichte“ führen.
Die etwa achtzig Jahre andauernde Epoche von 1866 bis 1945, geprägt von einem
übersteigerten Nationalismus und gleichzeitig aggressiver Abgrenzung gegen andere
Völker, was zu brutalen Kriegen führte, erscheint uns heute fremd. Das gilt auch für
die „deutsch-französische Erbfeindschaft“ und die Glorifizierung gefallener Soldaten
als „Helden“. Wichtige Akteure in diesem Zusammenhang waren die lokalen
Kriegervereine und der 1899 gegründete „Deutsche Reichskriegerbund Kyffhäuser“,
die sich nicht nur um militärische Traditionspflege und angemessene Begräbnisse für
Soldaten kümmerten, sondern auch politisch gegen Bestrebungen zur
Völkerverständigung agierten und die „Bereitschaft zum Krieg“ in der Gesellschaft
förderten. (1)
Das Denkmal zum deutsch-deutschen Krieg (1866) und zum deutsch-
französischen Krieg 1870/71
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es keinen deutschen Staat, nur 35
Fürstentümer und Königreiche sowie vier freie Städte, die Mitglieder des „Deutschen
Bundes“ waren. Das deutsche Volk kämpfte in der Revolution von 1848/49 für
demokratische Freiheiten und einen Nationalstaat. Diese scheiterte jedoch und der
deutsche Nationalstaat entstand 1871 durch Kriege unter der Regie des preußischen
Ministerpräsidenten und späteren Reichskanzlers Otto von Bismarck. Dafür steht das
erste Denkmal: Durch einen Sieg über Österreich hatte Preußen 1866 seinen
Führungsanspruch im Deutschen Bund verdeutlicht. Der siegreiche deutsch-
französische Krieg 1870/71 führte zur Krönung des preußischen Königs zum
deutschen Kaiser im Schloss von Versailles, was eine besondere Demütigung
Frankreichs bedeutete.
(1) Nach: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, Ausarbeitung WD1–3000/078/11,
Geschichte der Krieger-, Kameraden- und Reservistenvereine in Deutschland, 15. Sept. 2011, S. 9.
Vgl. auch Dieter Düding: Die Kriegervereine im wilhelminischen Reich und ihr Beitrag zur
Militarisierung der deutschen Gesellschaft, in: J. Dülffer/K. Holl (Hg.), Bereit zum Krieg, Göttingen
1986, S. 103–106.
Das Denkmal stellt eine Siegessäule dar: Erhaben, herrschaftlich und wachsam
breitet ein Adler, der das Wappentier Preußens und des Deutschen Reiches war, auf
einer Weltkugel an der Spitze der Säule seine Flügel aus. Die mit Lorbeergirlanden
und Eichenlaub versehene Säule zeigt die Namen von Kriegsteilnehmern und
Gefallenen. Oben sind die Orte der bedeutenden Siege zu lesen, nicht zuletzt Sedan,
wo die kriegsentscheidende Schlacht sich ereignete. Die Auf- bzw. Inschriften
verdeutlichen eine von Nationalstolz und Militarismus geprägte Atmosphäre, was
durch das Eiserne Kreuz (2) und die von Eichenlaub und Schwertern geschmückte
Kaiserkrone bildhaften Ausdruck findet.

Im Rahmen einer Festveranstaltung, an der 14 Vereine teilnahmen, wurde das
Denkmal geweiht. Es sollte das Andenken an die „Streiter für das Vaterland“
wachhalten, führte der Pfarrer aus. In der Festrede wurde hervorgehoben, dass das
Denkmal entsprechend der Inschrift „den Kriegern zur Ehr“ und der „Jugend zur Lehr“
errichtet wurde. Dafür biete gerade die Vorbereitung auf den Militärdienst ein weites
Betätigungsfeld, wobei die Jugendlichen vom heldenhaften Verhalten der Soldaten
lernen sollten. (3) Das passte zum Zeitgeist in der Phase des Imperialismus, als die
deutsche Politik unter Kaiser Wilhelm II. das Deutsche Reich zu einer Weltmacht mit
Kolonien machen wollte. Damit wuchsen auch die Spannungen mit anderen
Weltmächten, insbesondere Großbritannien und Frankreich. Dass dieses Denkmal
im Juni 1914 – nur wenige Wochen vor dem als Auslöser des ersten Weltkrieges
geltenden Attentats von Sarajewo – eingeweiht wurde, entbehrt nicht einer gewissen
tragischen Ironie.
Das Denkmal zum ersten Weltkrieg (1914–1918)
Im November 1918 endete der Erste Weltkrieg mit der Niederlage Deutschlands und
Österreich-Ungarns. In diesem ersten industriellen Krieg hatten etwa zehn Millionen.
Soldaten und sieben Millionen Zivilisten den Tod gefunden. Die Weigerung von
Matrosen Ende Oktober 2018 mit ihren Schiffen zu einer militärisch sinnlosen
Schlacht gegen die britische Flotte auszulaufen, löste die Novemberrevolution aus:
Das Kaiserreich wurde gestürzt und mit der „Weimarer Republik“ entstand die erste
Demokratie in Deutschland. Viele monarchistisch orientierte Militärs lehnten die
Demokratie ab, dennoch suchte die Regierung den Kompromiss und verzichtete auf
eine grundlegende Heeresreform. Auch wurde wenig getan, um eine infolge des
Kriegserlebnisses „verlorene Generation“ in die zivile Gesellschaft zu integrieren. Ein
Krisenzeichen war, dass 1925 der frühere Chef des Generalstabs und Monarchist
Paul von Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt wurde. Hindenburg gehörte zu
den maßgeblichen Unterstützern der „Dolchstoßlegende“, einer Lüge, wonach
(2) Das Eiserne Kreuz wurde als militärischer Verdienstorden für soldatische Tapferkeit erstmals in den
Befreiungskriegen gegen Napoleon ab 1813 durch den preußischen König verliehen. Seitdem wurde
es sowohl im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 als auch später im Ersten und Zweiten Weltkrieg
erneut an deutsche Soldaten verliehen. Nicht der Orden selbst, aber seine Form wurde nach dem
Zweiten Weltkrieg wieder aufgegriffen. In der Bundesrepublik Deutschland erscheint das Eiserne
Kreuz als stilisiertes Symbol auf allen Kampffahrzeugen und Flugzeugen der Bundeswehr und dient
damit als Erkennungszeichen der deutschen Streitkräfte.
(3) Informationen zur Einweihungsfeier nach dem Artikel „Denkmalsweihe in Somborn“, in: Kreisblatt –
Amtlicher Anzeiger für die Stadt und den Kreis Gelnhausen, 9. Juni 1914.
Pazifisten, streikende Arbeiter – insbesondere im Januar 1918 kam es nach dem
Hungerjahr 1917 zu Massenstreiks – und die Revolutionäre vom November 1918 für
die Kriegsniederlage verantwortlich seien. Dagegen hatte Hindenburg im Oktober
1918 gegenüber der Reichsregierung selbst die Forderung nach Aufnahme von
Friedensverhandlungen mit der militärischen Überlegenheit der gegnerischen
Truppen begründet. Die Deutschnationalen und später vor allem die
Nationalsozialisten nutzten die „Dolchstoßlegende“, die sich zur Begründung eines
Revanchekrieges eignet, zur Hetze gegen die Republik und die sie vertretenden
Politiker als „Novemberverbrecher“.
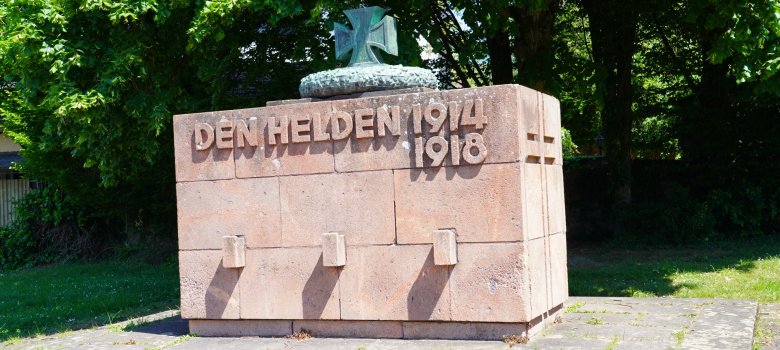
Auch bei den Kriegervereinen, die in den 1920er Jahren für den Aufbau von
Denkmalen für den Ersten Weltkrieg aktiv wurden, fand diese Lüge breite
Unterstützung. Zu diesen vermerken Historiker: „Die überwiegende Mehrzahl der
Denkmäler ist geprägt durch einen – oft christlich verbrämten – dumpfen Heroismus,
in dem die Niederlage verdrängt, oder gar in einen Sieg uminterpretiert wird.“ (4)
Denkmale, die als Konsequenz des Krieges eine Friedensbotschaft formulierten,
waren die Ausnahme und wurden später von den Nationalsozialisten zerstört.
In Somborn wurde ein Kriegerdenkmal zum Ersten Weltkrieg bereits in der ersten
Hälfte der 1920er Jahre geplant, konnte aber wegen fehlender Mittel zunächst nicht
realisiert werden. Das Engagement des Kriegervereins und seines Vorsitzenden
führte schließlich dazu, dass es Ende 1933 unter Leitung des Architekten Reuther
aus Meerholz auf dem Hindenburgplatz bei dem Denkmal für die Kriege von 1866
und 1870/71 errichtet wurde. Somborner Fuhrwerksbesitzer hätten dafür zur
Auffüllung des Platzes 400 Kubikmeter Erde ohne Bezahlung angefahren. (5)
Auch wenn dieses Denkmal in der Ära des Nationalsozialismus realisiert wurde, ist
es vergleichbar mit vielen Denkmalen der 1920er Jahre, für die monarchistische und
deutschnationale Vorstellungen stilbildend waren. Das Denkmal, ein massiver
Steinblock, erinnert an einen Altar. Dazu passt das darauf stehende und in Bronze
gearbeitete „Eiserne Kreuz“, das auch bereits beim ersten Denkmal als Symbol
soldatischer Tapferkeit erscheint. Zusammen mit der Aufschrift auf der Vorderseite
„Den Helden 1914–1918“ entsteht so der Eindruck, der Altar symbolisiere die
„heldenhafte“ Opferbereitschaft deutscher Soldaten. Andererseits kann man den
Steinblock auch als stilisierten Sarkophag (Steinsarg) auffassen, wobei der auf dem
Steinblock liegende – ebenfalls in Bronze gearbeitete – Eichenlaubkranz an den
üblichen Sargschmuck traditioneller Bestattungen erinnert. Zusammen mit den
eingearbeiteten christlichen Kreuzen auf den Seiten sowie den Namen der
(gefallenen) Soldaten auf der Rückseite wird noch stärker der Eindruck erweckt, man
wolle nicht nur den Heldenmut der Soldaten ehren, sondern insbesondere der
gefallenen „Helden“ gedenken. Bei der Einweihungsfeier für das Denkmal am 26.
August 1934 erhielt das Denkmal durch den Pfarrer die kirchliche Weihe und der
(4) Michael Jeismann / Rolf Westheider: Wofür stirbt der Bürger? Nationaler Totenkult und
Staatsbürgertum in Deutschland und Frankreich seit der französischen Revolution, in: Reinhart
Koselleck / Michael Jeismann (Hg.): Der politische Totenkult: Kriegerdenkmäler in der Moderne,
München 1994, S. 23–50, hier S. 29.
(5) Vgl. Artikel „Somborn ehrt seine Gefallenen – Einweihung eines Ehrenmals“, Gelnhäuser Tageblatt,
27.8.1934. Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung der Denkmaleinweihung sind diesem Artikel
entnommen.
Kriegerverein stellte es unter den Schutz der Gemeinde Somborn. Der Vorsitzende
des Vereins hatte für dieses Ereignis eine Sammlung von Briefen der Gefallenen mit
Skizzen des „Heldentodortes“ als Buch konzipiert. Mit dem Denkmal habe die
Gemeinde einen Teil ihrer Schuld gegenüber den Kriegern abgetragen, führte er aus.
Um die „Dankesschuld“ ging es auch in dem Beitrag eines Schülers und der Landrat
mahnte in seiner Ansprache die Jugend an, in die „Fußstapfen der teuren
Gefallenen“ zu treten. Für Deutschland sei kein Opfer zu groß. Gesungen wurde das
Lied „Morgenrot“, welches höchstwahrscheinlich mit dem Text „Reiters Morgenlied“
von Wilhelm Hauff verbunden war. In diesem wird der frühe Tod eines jungen
Soldaten im Krieg verklärt.
Die Somborner Denkmaleinweihung spiegelt auch Ideen bedeutender deutscher
Intellektueller wider, die die Überlegenheit deutscher Kultur im Zusammenhang mit
Krieg, der eine Chance zur Förderung echter Werte biete, und dem als sinngebend
glorifizierten Opfertod auf dem Schlachtfeld hervorhoben. (6) Der Historiker Oliver Janz
bemerkt, dass Deutschland mit dem Gefallenenkult den Krieg nicht wirklich beendet,
sondern seinen Toten ein Vermächtnis zugeschrieben habe, das sich nur durch
weitere Kriege einlösen lasse. (7) Durch die Umdeutung der Geschichte und die
Forderung einer Revanche für die Kriegsniederlage gedachte man eben nicht nur der
Toten, sondern verklärte die Gefallenen zu „Helden“. (8) Ihr „Opfer“ würde nicht
vergeblich sein, wenn man – wie nationalistisch-völkische und militaristische Kreise –
den durch die Niederlage erreichten Zustand nicht als endgültig und unumkehrbar
ansähe. Fünf Jahre nach der Einweihung des Denkmals in Somborn erfüllte sich
diese düstere Perspektive durch das NS-Regime, dem bei der Einweihungsfeier mit
„Sieg Heil“ gehuldigt worden war. Im Zweiten Weltkrieg wurden auf dem
Hindenburgplatz mit seinen Denkmalen Soldaten zum Fronteinsatz verabschiedet.
Das lässt aus dem Rückblick die Einweihungsfeier als makabren Totentanz
erscheinen: Die Helden von 1914–1918, an die mit dem Denkmal erinnert werden
soll, waren zunächst Opfer des Krieges, deren Erinnerung zur Mobilisierung für einen
weiteren Opfergang missbraucht wurde.
Das Denkmal zum zweiten Weltkrieg (1939–1945)
Der vom nationalsozialistischen Deutschland im Zusammenhang einer von
Weltmachtstreben und rassistischen Überlegenheitswahn bestimmten Ideologie
begonnene Zweite Weltkrieg endete in der totalen Niederlage des „Dritten Reiches“:
Nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht gab es keinen deutschen
Nationalstaat mehr, sondern Besatzungszonen und später ein geteiltes Land. Auch
wegen beispielloser Verbrechen, wie dem Holocaust, die im deutschen Namen
verübt wurden, war die Glorifizierung der Soldaten als Helden nicht mehr möglich.
Dieser Hintergrund zeigt sich auch in dem dritten Denkmal, einem 1975 von der
Gemeinde Somborn den „Opfern von Krieg und Gewalt 1939–1945“ gewidmeten
(6) Vgl. Kurt Flasch: Die geistige Mobilmachung. Die deutschen Intellektuellen und der Erste Weltkrieg.
Ein Versuch, Berlin 2000.
(7) Vgl. Oliver Janz: Der große Krieg, Bonn 2013, S. 358.
(8) Vgl. Blümel, Eileen: Aus Helden werden Opfer, in Spessart. Monatszeitschrift für die Kulturlandschaft
am Main, 2021 (115), S. 12–17.
Mahnmal: Ein durchbrochenes Kreuz in alle vier Himmelsrichtungen zeigend, dient
als Ansatzpunkt für Gedenken ohne den Versuch, eine Sinnstiftung für einen
„sinnlosen Opfertod“ zu erzeugen. (9) Es finden sich keine Symboliken des
Nationalstolzes oder Zeichen militärischer Tapferkeit. Nicht eine Verehrung der
„Krieger“ oder eine Heroisierung der gefallenen Soldaten wird hier also zum
Ausdruck gebracht. Stattdessen gilt das Denkmal allen, die direkt oder indirekt Opfer
des NS-Regimes und des von ihm entfachten Weltkriegs wurden.

Allerdings läßt sich hinsichtlich der Inschrift mit dem Bezugszeitraum von „1939–
1945“ kritisch hinterfragen: Gab es in den Jahren von 1933 bis 1939 keine Opfer des
Nationalsozialismus – oder verdienen diese keine Erwähnung? Müsste nicht auch
über die Ursache der Gewalt und die Täter gesprochen werden? Sofort nach ihrer
Machtübernahme führten die Nationalsozialisten „Krieg“ gegen einen Teil des
deutschen Volkes, vor allem die politische Opposition (Arbeiterbewegung,
Demokraten und Pazifisten). Diese Menschen füllten die ersten Konzentrationslager
oder wurden zur Emigration gezwungen. Nach der „Dolchstoßlegende“, deren
entschiedener Anhänger Hitler war, mussten diese Kräfte ausgeschaltet werden,
wenn der nächste Krieg zum Sieg führen sollte. Die Revanche für die Niederlage im
Ersten Weltkrieg gehörte von Anfang an zum Programm des NS-Regimes.
Die Weihe des Denkmals durch Pfarrer beider Konfessionen erfolgte im Rahmen des
Jubiläumsfestes zum 950jährigen Bestehen von Somborn im August 1975. Ein
Vertreter des VDK dankte für die Errichtung des Mahnmals und forderte, dass das
Gedenken an die Toten auch eine Mahnung für die Lebenden sein möge. Das Kreuz
gelte als Zeichen der „Leiden und Schmerzen“, aber auch der „Hoffnung und
Auferstehung“, so erläuterte der Beigeordnete Schilling in seiner Rede die
Gestaltung des Denkmals. Er rief die Menschen – insbesondere die Jugend – auf,
„niemals wieder Unrecht, Gewalt und Krieg“ zuzulassen. (10)
Der Platz mit den Denkmalen in Somborn könnte als Metapher für einen langen und
noch keineswegs abgeschlossenen Weg zu dem Ziel einer Welt ohne Krieg und
einer Konfliktregelung mit friedlichen Mitteln aufgefasst werden. Diesen Weg
kennzeichnen nicht nur Staatsverträge, die der Aussöhnung und Partnerschaft mit
Frankreich, Polen und der Sowjetunion dienten, beispielsweise der Elysée-Vertrag
(1963), der Warschauer Vertrag (1970) und der Moskauer Vertrag (1970). Von
Bedeutung sind auch lokale Initiativen und Basisaktivitäten, wie
Gemeindepartnerschaften und Schüleraustausche bis hin zu der Verbreitung von
Freundschaften zwischen Menschen aus der ganzen Welt.
(9) Zum Typus von Denkmalen in diesem Zeitraum vgl. auch Marco Dräger: Denkmäler im
Geschichtsunterricht, Frankfurt 2021, S. 16–17. Dräger konstatiert einen Trend zur Abstraktion mit
Verzicht auf konkrete Sinnstiftung, der den Betrachter zu Reflexion zwinge.
(10) Vgl. Artikel „Ansager vom Deutschlandfunk maß Freigerichter mit europäischer Elle: Ihr seid die
Spanier der Hessen!“, in: Wetterauer Zeitung, 11. August 1975.
